Funkenschlosser
Stammgast
- Seit
- 25. Nov. 2011
- Beiträge
- 4.491
Im Bosch Z-Regler (aus den fünfziger Jahren) ist kein Bi-Metall. Da gibt es nur zwei Einrichtungen: der Rückstromschalter, der die Verbindung zwischen Batterie und LiMa schließt, sobald die LiMa mehr Spannung generiert hat als die Batterie. Parallel dazu liegt das rote Birnchen. Der zweite, rein magnetisch gesteuerte Kontakt ist der Regelschalter: dieser legt bei kleinen LiMa-Spannungen die Feldwicklung an volle Spannung, bei mittleren Spannungen über den Vorwiderstand an die volle Spannung, und bei zu hohen LiMa Spannungen wird die Erregerwicklung von der Versorgungsspannung getrennt.
Temperatursteuerung wäre auch nicht wirklich sinnvoll: manchmal sitzt der Regler vorn im Räderkasten direkt neben der LiMa (z.B. R25/3, R51/3) und manchmal ist der auch rausgebaut (war das nicht z.B. bei der R27 so? Da bin ich aber nicht sicher, ich kenne aber einige Umbauten, da ist das so).
Hallo Thomas, es war die Rede von der ersten Reglergeneration der Drehstromlichtmaschinen. Bezeichnung: AD1/14 erkennbar an dem großen Blechgehäuse und dem gelben Isolierband auf der Fuge zwischen Deckel und Unterteil.

 )
)

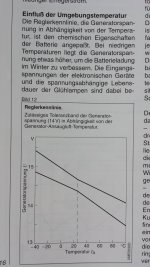






 für Deinen Mut, solche Bilder hier zu zeigen.
für Deinen Mut, solche Bilder hier zu zeigen.