Hast Du einen Tip für ein Buch, das ähnlich einfach/einleuchtend aufgebaut ist?
Es würde mir helfen eine große Wissenlücke zu füllen - strommäßig bin ich nämlich ein ziemlicher Analphabet!
Hallo,
nicht nur Einen:
1.
Carl Hertweck: Der Kupferwurm; gibt's als Reprint beim MOTORBUCH-Verlag; das Original von 1961 - glaub ich - rückt eh Keiner raus.
Vorteil: Im ersten Kapitel werden Strom, Spannung, Widerstand usw. nicht nur einfach und einleuchtend allgemein erklärt, sondern gleich die wesentlichen Bezüge zur KFZ-Elektrik aufgebaut.
2.
Hans Hohmann: MOTORRAD-ELEKTRIK in der Praxis; bei Delius Klasing
Ähnlich laiengerecht aufgemacht wie 1, aber natürlich mit mehr Bezug zu aktueller KFZ-Elektrik; viele nette Tips für selbstgemachte Prüfaufbauten.
3.
Eduard Max Schmidt: Elektrik am Motorrad Teil 1 und Teil 2; bei Bucheli-Verlag, Bände 5008 und 5009 (in Deutschland über MOTORBUCH Verlag); wahrscheinlich neu nicht mehr zu bekommen, aber vielleicht im Antiquariat, auf Teilemärkten oder in der Bucht.
Wer sich diese beiden Bücher durch die Lappen gehen lässt ist selbst in Schuld, weil:
DAS IST MIT ABSTAND DAS BESTE, WAS JE IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM ÜBER MOTORRAD-ELEKTRIK VERFASST WURDE!!!!
Auch für den Laien verständlich und trotzdem fachlich absolut hochwertig. Kein Wunder: Hauptberuflich war der Mann damit beschäftigt, die Ahnungslosen aus dem Tal der Ahnungslosigkeit herauszuholen und auf den Olymp der KFZ-Technik zu hieven. Und: Der fuhr zur Zeit des Bücherschreibens eine 75/6 ........
4.
Frank Hahmann: Handbuch Motorrad Elektrik; bei Delius Klasing
Dick, schwer und inhaltsschwanger. Aber nur was für Leute mit soliden Vorkenntnissen, die sich schon länger und tiefer in die Elektrikmaterie vertieft haben; und endlich nicht nur wissen wollen wie es geht, sondern auch warum.
Zuletzt - obwohl danach nicht gefragt wurde - der Vollständigkeit halber:
DER OBERFLOP
5.
Martin Fischinger: Motorradelektrik; bei MOTORBUCH Verlag
Einfach liegen lassen. Das Verständnis dieses Buches setzt genau die Kenntnisse voraus, die es zu vermitteln vorgibt. Absolut überflüssig.
Gruß dabbelju





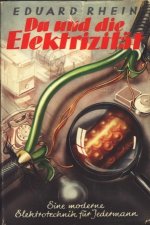

 ) weiter.
) weiter.

 , kannst Du 's mir bitte erklären?
, kannst Du 's mir bitte erklären?



