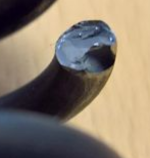mk66
Nr. 121
- Seit
- 24. Apr. 2007
- Beiträge
- 8.728
Beispiel in meinen Augen: Stoßdämpferfedern am Auto.Hielten die früher ewig sind die heute bei ca. 150.000km kaputt.
Vielfahrererfahrungen:
- Mein aktueller BMW (2010 - dato), akt. 250 TKM Fahrwerksfedern - alle vier die ersten
- Mein verblichener Saab (2002-2010), RIP (Motorschaden): 290 TKM- nie was an den Federn gewesen.
Vorher diverse Firmenschleudern von VW und Audi (würde ich mir privat nicht kaufen): Laufleistungen oft über 200 TKM. Fahrwerksfedern - nie was gewesen.
wenn ich nachdenke: in den letzten 32 Jahren mit weit über 1,5 Mio PKW-KM und x Autos: Es ist nie was an den Fahrwerksfedern gewesen.
Grüße
Marcus