Fortsetzung von oben:
Schalldämpferbau
Vorab: Hier geht es zwar um einen Zweitakter, jedoch ergibt sich aus der theoretischen Betrachtung und der handwerklichen Ausführung vieles als "Abfall"produkt, das allgemein anwendbar ist; auch 2-ventiler sollten auf ihre Kosten kommen!
Jetzt kommt nämlich die Füsick ins Spiel. Hier war jahrzehntelang verschüttetes Wissen aus der Schul- und Studienzeit wiederzubeleben. Rein hobbymäßig und ohne Druck hat das richtig Spaß gemacht :].
Nicht, daß wer meint, ich hätte den ultimativ leisen Wundertopf konstruiert - einstweilen bin ich froh, daß er im Standlauf nicht lauter als das Serienteil ist. Da geht noch was, denn die Rohrdurchmesser im Dämpfer sind reichlich ausgelegt und sollen sukzessive verkleinert werden, so lange, bis die Motorleistung anfängt zu sinken. Testfahrten werden gemacht, sobald das österliche Schneetreiben aufgehört hat ...

Schalldämpfung ist u.a. machbar mittels
- Querschnittsänderung
- Düse
- Volumenresonator
- Pfeifenresonator
- Absorptionsdämpfer
Der für unsere Gummikühe beliebte Absorptionsdämpfer (Siebrohr mit Schallschluck-Material drumherum) bringt beim 2-Takter eher enttäuschende Ergebnisse. Besser wirkt hier ein sog. Tiefpaßdämpfer, der dessen unangenehme, hochfrequente Geräusche vermindert. Er besteht aus mehreren Kammern, welche durch Röhrchen ("Pfeifen") miteinander verbunden sind. Abhängig von der Pfeifenlänge liegt die maximale Schalldämpfung bei einer bestimmten Wellenlänge Lambda, nämlich bei der 4-fachen Rohrlänge. Weitere Dämpfungsbereiche liegen bei ungeradzahligen Vielfachen dieser Rohrlänge (die man auch als Lambda : 4 beschreiben kann).
Wie lang sollen nun die Pfeifen sein? Da habe ich Formeln zusammengesucht und herumgerechnet, letztlich aber das Handtuch geworfen und pragmatisch gehandelt. Sinnvoll im Auspufftopf gegebener Größe unterzubringen sind nur einigermaßen kurze Pfeifen; also habe ich dreierlei Längen und eine Siebplatte vorgesehen, s. Bild. Falls wer dennoch Lust zum Rechnen hat, hier einige Formeln:
Tonhöhe
L = c : 2f (L = Rohrlänge in m; c = Schallgeschwindigkeit in Luft in m/sec; f = Tonhöhe/Frequenz in Hertz)
Wellenlänge
c = Lambda x f (c = Schallgeschwindigkeit, s.o.; Lambda = Wellenlänge; f = Frequenz, s.o.)
Als störende "Hoch"frequenz werden Tonhöhen oberhalb von etwa 500 Hertz angesehen.
Damit es schön unübersichtlich wird, kommen noch diverse Variablen hinzu:
- Die Schallgeschwindigkeit in Luft ist temperaturabhängig und liegt bei heißen Auspuffgasen wesentlich höher, z.B. bei 500 Grad C bei 558 m/s, bei 400 Grad C bei 520 m/s und bei 300 Grad C bei 480 m/s.
- Das Luftvolumen ist ebenfalls temperaturabhängig. Hier gilt das
Gay-Lussac' sche Gesetz
V1 : T1 = V2 : T2 = konstant
Das heißt, Volumen V und Temperatur T stehen in einem gleichbleibenden Verhältnis. Eine Abkühlung von z.B. 500 Grad C auf 400 Grad C (- 20%) verringert das Ausgangsvolumen um 20 %.
Weil es so schön ist, nun noch das
Hagen-Poiseuille' sche Gesetz
(ja, ich habe auch nachgesehen, wie man das richtig schreibt).
Die Formel erspare ich uns. Es geht hierbei um die Größe des Volumenstromes durch ein Rohr. Dies ist u.a. abhängig vom Innenradius des Rohres, dessen Länge und der Viskosität des strömenden Mediums.
Merken kann man sich folgendes, und das ist eine Nutzanwendung für alle Bastler:
Der Strömungswiderstand ist sehr stark abhängig vom Rohrmaß, nämlich der 4. (!) Potenz des Radius. Halbierung des Rohrdurchmessers erhöht den Strömungswiderstand somit um das 16-fache! Sicher interessant bei Überlegungen nicht nur bzgl. Auspuff, sondern auch bei der Auslegung von Ansaugwegen, Vergasergrößen usw.
Ferner steigt mit der Temperatur auch die Viskosität von Luft; der Strömungswiderstand erhöht sich (durch verstärkte Molekülbewegung und damit "Reibung" im Rohr).
Jetzt aber zum ehrbaren Handwerk!
Die unter Druck stehenden Aufpuffgase sollen nicht herumknallen, sondern idealerweise als ruhiger, gleichmäßiger Strom das System verlassen. Zweckdienlich müssen sie dafür entspannt und ihre Geschwindigkeit herabgesetzt werden. Dem ist ein möglichst großes Topfvolumen förderlich.
Als Topf dient ein 10 cm großes Alu-Rohr (Dank an König Otto!). Die runden Scheiben sind aus einem alten Straßenschild entstanden - vier Quadrate ausgeschnitten, zusammen auf eine lange M 6-Schraube gespannt, die Ecken abgesägt und dann auf der Drehbank rundgemacht. Verkehrsschilder (ausrangierte!

) liefern vielseitig verwendbares, 2 mm starkes Alu-Blech. Die Pfeifen sind aus dem Vollen gedreht und dann in die gebohrten Scheiben eingesetzt und verschweißt. Montiert ist alles auf einer Gewindestange; im Bild steckt diese in einer Bohrmaschine. So ging das Aufschrauben der Haltemuttern schneller. Das ganze Konglomerat ist in das Rohr eingeschoben und wird mit der Gewindestange im vorderen Abschlußdeckel gehalten. Hinten befindet sich als Abschluß und zusätzlicher Dämpfer ein runder Alu-Schöpflöffel

, verschweißt mit einem gedrehten Alu-Ring. In der Mitte steckt ein Stück Kupferrohr mit einem 90-Grad-Winkel (Heizungsbau). Damit werden die Abgase nach links unten abgeleitet zugunsten künftiger Beiwagen-Passagiere. Sonst steht denselben nach kurzer Fahrt das Wasser in den Augen

, und sie stinken ewig nach Auspuff.
Als Hitzeschutz dient ein Stück Edelstahl-Lochblech, gewonnen aus einem Wäscheabwurf, am Topf befestigt mit Blechschrauben. Zur Verstärkung sind darunter rundgebogene 2 mm-Alustreifen, ferner gedrehte Abstandshalter.
Bleibt noch das Verbindungsteil vom Auspuff zum Schalldämpfer. Das sollte nicht einfach nur ein simples Verbindungsrohr sein, sondern möglichst dem nachgeschalteten Dämpfer die Arbeit schon etwas erleichtern.
Die obige Theorie in die Praxis umgesetzt, soll es das auf mehrfache Weise tun (mag sein, daß die Erwartung überzogen ist; zumindest gibt es dem Betrachter optisch Rätsel auf

).
- Querschnittsänderung. Der Innendurchmesser springt nach dem Endrohr (stinger / bleed pipe) von 25 auf 37 mm, wodurch sich die Gase etwas entspannen können.
- Volumenänderung. Durch eingedrehte Rillen ist das Teil ein bißchen als Kühlkörper ausgebildet. Vgl. oben; nach Gay-Lussac sinkt das Gasvolumen prozentual gleich stark wie die Temperatur. Macht z.B. von 500 auf 400 Grad C immerhin 20 % aus. Gleichzeitig sinkt auch die Gasviskosität; wohl kaum spürbarer Effekt.
- Schallgeschwindigkeit. Sinkt auch mit der Temperatur, s.o.
Bleibt abzuwarten, was die Testläufe ergeben und was sich noch optimieren läßt. Als Erfahrungswert vom früher selbst gebauten Simson-Dämpfer habe ich, daß die Dämpfung oberhalb eines passenden Pfeifen-Innendurchmessers rapide nachläßt. Es bleibt spannend.
Korrekturen und ergänzende Anregungen sind willkommen!
Grüßle, Fritz.








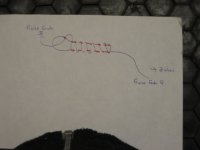



 Perfekt - besser wie im Lehrbuch erklärt
Perfekt - besser wie im Lehrbuch erklärt











 Schalldämpfer gepfriemelt und bin auf die Testpiste, eine Teerstraße in den Feldern. Dutzende Fahrten in Nieselregen und scharfem Wind mit unerwartet erfreulichem Ergebnis: Durch Hin- und Herschieben des Trichters ließ sich ein scharf begrenzter Optimalpunkt ermitteln, bei dem der Motor sauber ausdrehte. Im Bild sieht man Striche auf dem Konus, bis zu denen er jeweils eingeschoben war. Da, wo das + - Zeichen ist, liegt der Bestpunkt. Nur ein cm weiter rein oder raus, und der Motor dreht nicht vollends hoch. Der Resonanzpunkt war gefunden!
Schalldämpfer gepfriemelt und bin auf die Testpiste, eine Teerstraße in den Feldern. Dutzende Fahrten in Nieselregen und scharfem Wind mit unerwartet erfreulichem Ergebnis: Durch Hin- und Herschieben des Trichters ließ sich ein scharf begrenzter Optimalpunkt ermitteln, bei dem der Motor sauber ausdrehte. Im Bild sieht man Striche auf dem Konus, bis zu denen er jeweils eingeschoben war. Da, wo das + - Zeichen ist, liegt der Bestpunkt. Nur ein cm weiter rein oder raus, und der Motor dreht nicht vollends hoch. Der Resonanzpunkt war gefunden! ) macht zusätzlich was her. Und ein blecherner Metabo-Maschinenkasten vom Schrott mutierte mit Anstrich und ein paar Holzleisten zum oregenool WK II-Munitionsbehälter.
) macht zusätzlich was her. Und ein blecherner Metabo-Maschinenkasten vom Schrott mutierte mit Anstrich und ein paar Holzleisten zum oregenool WK II-Munitionsbehälter.






 ) liefern vielseitig verwendbares, 2 mm starkes Alu-Blech. Die Pfeifen sind aus dem Vollen gedreht und dann in die gebohrten Scheiben eingesetzt und verschweißt. Montiert ist alles auf einer Gewindestange; im Bild steckt diese in einer Bohrmaschine. So ging das Aufschrauben der Haltemuttern schneller. Das ganze Konglomerat ist in das Rohr eingeschoben und wird mit der Gewindestange im vorderen Abschlußdeckel gehalten. Hinten befindet sich als Abschluß und zusätzlicher Dämpfer ein runder Alu-Schöpflöffel
) liefern vielseitig verwendbares, 2 mm starkes Alu-Blech. Die Pfeifen sind aus dem Vollen gedreht und dann in die gebohrten Scheiben eingesetzt und verschweißt. Montiert ist alles auf einer Gewindestange; im Bild steckt diese in einer Bohrmaschine. So ging das Aufschrauben der Haltemuttern schneller. Das ganze Konglomerat ist in das Rohr eingeschoben und wird mit der Gewindestange im vorderen Abschlußdeckel gehalten. Hinten befindet sich als Abschluß und zusätzlicher Dämpfer ein runder Alu-Schöpflöffel  , und sie stinken ewig nach Auspuff.
, und sie stinken ewig nach Auspuff.  ).
).

















 .
.
 ). Ein Hochleistungstuning ist das hier ohnehin nicht. Hauptsache, der Drehmomentverlauf läßt sich ein wenig günstiger gestalten.
). Ein Hochleistungstuning ist das hier ohnehin nicht. Hauptsache, der Drehmomentverlauf läßt sich ein wenig günstiger gestalten. , und was der ungeöffnete Motor aus dem Teilefundus so meint? Jedenfalls bleibt das Boot zunächst so verheizt, wie es ist; das wird eine rollende Restaurierung.
, und was der ungeöffnete Motor aus dem Teilefundus so meint? Jedenfalls bleibt das Boot zunächst so verheizt, wie es ist; das wird eine rollende Restaurierung.



